Dr. Gerd B. Achenbach
Philosoph
Dr. Gerd B. Achenbach ist Philosoph und Begründer der Philosophischen Praxis in Deutschland. Sein Verhältnis zur Philosophie ist akkurat ein Liebesverhältnis, das durch andere Philosophen, denen er begegnete, „geweckt” wurde. Dass ihm diese Liebe passiert ist, dafür ist er dankbar.
PV:
Dr. Achenbach, worum geht es im Leben?
GA:
Die wichtigsten Dinge im Leben geschehen in der Regel nicht aufgrund von Gründen, sondern sie fädeln sich ein, ereignen sich.”
Zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass ich mir Ihre Frage meinerseits in einem etwas anderen Zuschnitt angezogen habe. Statt zu fragen, „worum es im Leben geht”, bevorzuge ich die Wendung, „worauf es ankommt”. Die beiden Wendungen sind zwar einander ähnlich, aber doch nicht „Hose wie Jacke”. Verwandte Wendungen sind etwa: „Was ist wahrhaft wichtig im Leben?” oder: „Was gibt den Ausschlag?” oder: „Was ist letztlich entscheidend?” Was nun aber die Beantwortung solcher Fragen angeht, lege ich Wert auf die Feststellung, dass, was immer man als Antwort darauf anführen mag, grundsätzlich nur in Form eines Bekenntnisses vorgetragen werden kann. Mit andern Worten: Keine denkbare Antwort kann den Anspruch erheben, allgemein gültig und eine für alle verbindliche Wahrheit zu sein. Sondern: Wer auf solche Fragen antwortet, bekennt damit, wer er ist. Der eine sagt, es komme ihm aufs Vergnügen und das Optimum an Lebensfreude an, der andere gesteht, ihm sei vornehmlich daran gelegen, Verdrießlichkeiten zu vermeiden. Ein wieder anderer hegt den stillen Wunsch, jedenfalls das Schlimmste, was das Leben so in petto habe, möge ihm erspart bleiben. In schlichter Version wünscht man sich dann „Gesundheit”, denn ohne die sei alles nichts, wie es heißt. Und? Ist die Version des einen auch für den andern verbindlich? Keineswegs. Aber wir wissen, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, mit wem wir es zu tun haben. Redensartig: Wes Geistes Kind er ist.
Nun wollen Sie allerdings eine Antwort von mir. Gut. Ich sage, es kommt alles darauf an, das Leben so zu führen, dass ich ohne allzu großes Erschrecken mir selber in die Augen schauen kann. Was übrigens einer alten Tradition entspricht, die seit Sokrates in der Welt ist. Dessen Empfehlung lautete, sorge dich in erster Linie um dich oder, wie es damals hieß: um deine Seele. Wobei „Seele” fast nichts mit dem zu tun hatte, was heute „Psyche” heißt, sondern es war der Inbegriff dessen, was den inneren, den eigentlichen Menschen ausmacht. Mit andern Worten: Sorge dich, dass du gut wirst. Und dafür ließe sich auch sagen: Sieh zu, dass du dich ‒ unter Anlegung Deiner strengsten Maßstäbe ‒ vor dir selber verantworten kannst.PV:
Was war der Grund, weshalb Sie sich der Philosophie zugewandt haben?
GA:
Die wichtigsten Dinge im Leben geschehen in der Regel nicht aufgrund von Gründen, sondern sie fädeln sich ein, ereignen sich. Und das gelingt gewöhnlich, ohne dass es ordentlicher „Gründe” dafür bedürfte. Und so würde ich sagen, die Begegnung mit der Philosophie, die mich dann nie mehr losgelassen hat, die ist mir widerfahren, und zwar im Sinne einer Verführung. Einer lobenswerten Verführung, wie ich hinzusetzen möchte. Es gibt Verführungen, für die ist man ein Leben lang dankbar. So ist schon mancher in eine Liebesbeziehung „hineingeraten”, die sich im Laufe seines Lebens als glücklich und schätzenswert erwies und nun kann er sagen: Das ist mir passiert, und ich bin dankbar dafür. Der Vergleich ist keineswegs weit hergeholt, sondern mein Verhältnis zur Philosophie ist akkurat ein Liebesverhältnis, das durch einige Philosophen, denen ich begegnen durfte, „geweckt” wurde. Karl-Friedrich von Weizsäcker gehört dazu, später, im Studium, war es zunächst Günter Rohrmoser. Das waren nicht die gewöhnlichen öden, langweiligen Wissenschaftler, nicht die „Denkbeamten und Begriffsverwalter”, wie Paul Feyerabend sie titulierte, sondern Menschen, die von der Weise ihres philosophischen Denkens durchdrungen waren, so dass sie zu dem geworden waren, worüber sie sprachen. Das ist es, was mich überzeugt und für die Philosophie gewonnen hat. Dagegen hat mich der Typus „Vertreter dieser oder jener Wissenschaft oder Theorie” stets gelangweilt.
PV:
Wie ist es zu der Philosophischen Praxis gekommen?
GA:
Nun, ich hätte allen Grund, zunächst einmal zu sagen: In die sei ich nicht „hineingeraten”, sondern für die Gründung der Philosophischen Praxis habe es Gründe gegeben. Anders formuliert: Das war ein wohlüberlegter Schritt und Entschluss. Und so war es auch. Dennoch gilt ebenso: Selbst ein so bedachter und rechtfertigungsfähiger Akt, mit dem eine Idee „ins Leben gerufen wird” wie die Philosophische Praxis ‒ ein Neuling in der Welt damals ‒, hat seine Vorgeschichte. Und in die bin ich wiederum „hineingeraten”.
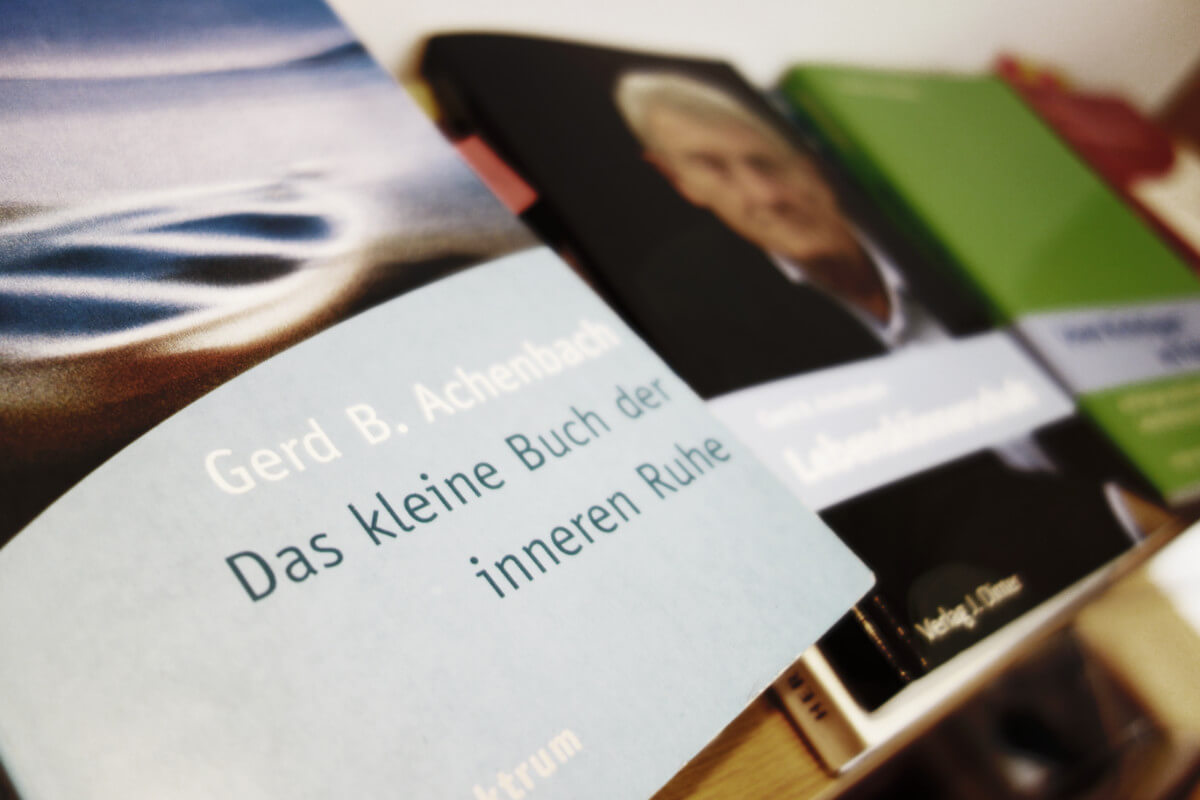
PV:
Und das war welche?
GA:
Die Begegnung mit der Philosophie, die mich dann nie mehr losgelassen hat, die ist mir widerfahren, und zwar im Sinne einer Verführung.”
Ich studierte noch, da kam eines Tages ein ferner Bekannter zu mir und berichtete, seine Tochter, 17, habe versucht, sich ums Leben zu bringen. Es hatte nicht viel gefehlt, und es wäre ihr der Anschlag gelungen. Doch man fand sie eben noch rechtzeitig auf, mit Blaulicht hat man sie ins Hospital gebracht, hat sie ins Leben zurückgeholt und danach, wie gesetzlich vorgeschrieben, wurde sie der Psychiatrie überstellt. Dort aber habe sie jegliche Zusammenarbeit mit dem zuständigen Psychiater verweigert. „Und nun?” „Und nun”, sagte mein Bekannter, „komme ich zu dir, weil ich meine, du solltest mit meiner Tochter reden. Mit den Psychiatern und Psychologen spricht sie nicht. Aber du bist Philosoph, mit dir ist es was anderes.” Das war ein verblüffender Antrag, und man könnte sagen: Da hat dieser ferne Freund, ein Künstler nebenbei bemerkt, in gewissem Sinne die Philosophische Praxis „erfunden”, so wie eine Nachfrage ein Angebot stimuliert.
Was ist passiert? Ich war bereit, zu versuchen, was anderen offenkundig nicht gelang ‒ und es ist gelungen. Also: Das Mädchen kam, wir sprachen miteinander, das ging einige Wochen so, mehrere Stunden am Tag, und ich habe erleben dürfen, dass dieses Gespräch eine außerordentlich hilfreiche Wirkung entfaltete. Inzwischen ‒ die Geschichte ist viele Jahre her, ich meine, es ist 1977 gewesen, 1981 habe ich die Praxis gegründet ‒, inzwischen ist sie schon lange verheiratet und ihre Kinder studieren.
Was war das nun? Ich habe seinerzeit einen Schluß daraus gezogen. Ich habe mir gesagt: Die Philosophie braucht einen Ort, an dem sie Erfahrungen sammeln, an dem sie lernen, dazulernen kann, nicht zuletzt: wo sie aus Fehlern lernen kann. Das hatte ihr, im Gegensatz zu den Wissenschaften, bisher gefehlt: In den Wissenschaften gehen sie mit einer Vermutung ans Werk, kreieren Experimente, mit denen sich die Hypothesen überprüfen lassen, und dann schauen sie nach, ob ihre Annahmen bestätigt werden oder nicht. Das fehlte der Philosophie. Ein Gedanke von C. G. Jung hat mich damals sehr beeindruckt. Der lautete sinngemäß: Es lasse sich „mit einer unzulänglichen Theorie bekanntlich sehr lange aushalten”, man dürfe sie nur nicht anwenden ..., denn in der Praxis erfahre man, was damit los ist (oder eben nicht). Das ist es, dachte ich damals, was die Philosophie nötig hat.
Etwas anderes kam hinzu: Fehlte der Philosophie die Praxis, so der Psychologie, die als Psychotherapie ja durchaus Praxiserfahrungen sammelt, eine philosophisch hinlängliche Theorie. Oder sagen wir es so: Was dort, bei den Psychotherapeuten, als Theorie ausgegeben wird, hält einer philosophischen Visitation nicht stand. Den Fehler eigentlich aller an einem problematischen Theorieverständnis leidenden Psychologietraditionen hat der wundervolle Nicolás Gómez Dávila in einem Satz auf den Punkt gebracht: „Jede wissenschaftliche Psychologie ist ihrem Wesen nach falsch, weil sie das als Objekt auffassen will, dessen Natur gerade darin besteht, Subjekt zu sein.” Aus beiden Wahrnehmungen resultierte für mich eine Folgerung: Wir brauchen ein Philosophische Praxis als Alternative zu den Therapien. Soweit in Kurzfassung meine Auskunft „zu den Gründen”, die zur Gründung der Philosophischen Praxis führten.PV:
Was macht der Alltag mit Ihnen? Gibt es den für Sie überhaupt?
GA:
Glauben Sie mir: Ein Vater von acht Kindern weiß, was „Alltag” heißt. Doch Sie wollen auf anderes hinaus, wollen wissen, was der Alltag mit mir ‒ womöglich „aus mir” macht? Also gut. Ich denke, den Alltag bestimmt, dass er uns mit einer Fülle kleiner Anforderungen zum Reagieren nötigt und uns vor allem Tag für Tag belehrt, dass das Leben nicht so ist, wie wir es uns dachten. Einfachste Formel: Wir erwarten etwas vom Leben, doch das Leben erwartet etwas von uns. Die Situation, in der von uns erwartet wird, dürften wir „Alltag” nennen. Und was macht das „mit”, schärfer noch: „aus” uns? Antwort: Erwachsene. Und Erwachsenwerden ist der Anfang aller Weisheit.
PV:
Geht es auch etwas kleiner?
GA:
Wenn Sie wollen ... Also: Die Prosa des Alltagslebens stabilisiert mich. Das heißt beispielsweise: Morgens aufstehen und anfangen, dies und das zu tun. So ziehen Kontinuität und Vertrautheit durch Routine ins Leben ein, wirksame Stabilisatoren. Außerdem ‒ für einen Philosophen höchst begrüßenswert ‒ sorgt die Vielzahl der täglichen Ansprüche en détail dafür, dass auch der, der ansonsten gern in Gedanken lebt, nicht „abhebt”. Da gilt das Vorrecht des Naheliegenden vor dem Fernliegenden, des Kleinen vor dem Großen. Im übrigen wage ich die Behauptung: Ein Leben ohne Alltag, eines, in dem alles nach den eigenen Wünschen ginge, wäre nicht nur unheimlich, es wäre am Ende langweilig. Der Gott des Alltags bewahrt uns davor.
PV:
Welcher Mensch hat Sie am meisten geprägt?
GA:
Auch er hat mich geprägt, seine Art des dialektischen Denkens, seine beispiellose Fähigkeit, das Denken der Philosophie im Verständnis der alltäglichsten Dinge zu bewähren.”
Die Antwort fällt mir leicht: meine Mutter. Was allerdings nichts Besonderes ist, denn selbst dann, wenn Mütter eine Katastrophe sind ‒ von dieser Sorte gibt es reichlich, wie wir wissen ‒, selbst dann sind sie es vor allem, die uns prägen. Doch dann muss ich sagen: Nahezu ebenso viel hat mich mein Vater geprägt. Diesem Monstrum von Vater gegenüber blieb mir als Sohn die charmante Rolle des permanenten Versagers ... Er war in schrecklich vielen Hinsichten einfach gut. Für einen Sohn: Anlass zur Bewunderung, andererseits war’s zum Verzweifeln. Sowas prägt. Ansonsten wurden es immer mehr fernere Gestalten, die mich prägten oder, wie ich jetzt besser sagen sollte: die mir zum Leitbild wurden. Das herausragende Beispiel: Sokrates. Oder dann so ein Denkmonster wie Hegel: Auch er hat mich geprägt, seine Art des dialektischen Denkens, seine beispiellose Fähigkeit, das Denken der Philosophie im Verständnis der alltäglichsten Dinge zu bewähren. Nietzsche schließlich: Sein Pathos und diese bis dahin nie gekannte Freiheit des Denkens, sein Experimentieren mit Perspektiven usw. Das wurde nicht einfach „Vorbild”, wie man sagt, solches Sich-frei-Machen des Geistes, wie wir es sonst nur von Goethe kennen, wurde mir zu eigen. Die haben in mir etwas aufgeschlossen, das niemand mehr zuschließt. Goethe, dieser Koloß souveräner Einsamkeit, wird mich nie zur Ruhe kommen lassen, wobei „Ruhe” hier kein Respektsbegriff ist, sondern das Faulwerden des Geistes meint. Übrigens bin ich überzeugt: Es ist gut, wenn viele uns prägen. Da werden Einseitigkeiten weggeschliffen und Vielfalt entwickelt. Was man Bildung nennen kann.PV:
Was lässt Sie heute immer noch so leidenschaftlich der Philosophie folgen?
GA:
Ich hatte nie das Gefühl, der Philosophie zu „folgen”, ich hatte immer das Gefühl, mich auf sie einzulassen. Das ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Ich bin kein Nachfolger, sondern eher noch müsste ich sagen, ich lasse den Reichtum der überlieferten Philosophie an mich heran, was aufwühlt, in Unruhe versetzt, zugleich belebt.
PV:
Aber wo sitzt Ihre Leidenschaft?
GA:
Die ist nicht sesshaft, die Leidenschaft. Ein interessanter Punkt. Den will ich erklären. Ehedem waren die Menschen Jäger und Sammler, zogen umher. Dann wurden sie sesshaft; das war im Neolithikum. Sie haben Mauern gebaut, eine Burg, haben sich auf ihrer Scholle festgesetzt. Seither wurde der Geist in Dienst genommen ‒ für die herrschende Religion, für die herrschenden Mächte, für den Zusammenhalt der Beherrschten. Aber einige blieben geistige Nomaden. Die stören jetzt den ordentlichen Betrieb. Und sind nötig, damit nicht alles, wohl etabliert, erstarrt. So geht es mir: Wenn ich mich eine Zeit lang mit irgendeiner geistigen Richtung beschäftige, besser: mich von ihr habe beschäftigen lassen, beginnt eine Art Zigeunerei in mir zu rumoren und das Gefühl meldet sich, ich sollte wieder aufladen, anspannen und weiterziehen. Das ist dann die Metamorphose vom Besitzenden zum Suchenden.

PV:
Könnte man es auch Offenheit nennen oder Neugier?
GA:
Die Philosophie ist unendlich reich an Gestalten, eine Fülle von Welten, bunt, vielfältig und voller Widersprüche, die zu denken geben, also stacheln und so das Weiterdenken animieren.”
Kann man. Vor allem aber ist es Bewegung. Ein Beispiel: Im Moment gestatte ich mir wieder einmal die Trance, in die den begeisterungsfähigen Leser ein Mann wie Oswald Spengler versetzt. Hundert Jahre „Untergang des Abendlandes”. Spengler nimmt den empfänglichen Leser gefangen, fesselt ihn, aber ich werde mich hüten, ihm ein Leben lang zu Füßen zu sitzen. Nein: Solche Lektüren sind Schübe, die man hinter sich bringt, die einen stärken, aber nur, wenn man sich aus ihnen wieder befreit. Die Romantik ist das Vorbild: Der Müller, der wandert, zieht ein, zieht wieder aus, zwischendrein das Liebchen verlockt, an Ort und Stelle zu bleiben, doch irgendetwas kommt dazwischen, also heißt es wieder: Abschied nehmen. Mir geht es so. Nicht mit „dem Liebchen” zwar, aber mit Lieblingslektüren beispielsweise. Philosophien sind für mich wie Herbergen, die mir vertraut sind. Ich gehe da ein und aus wie bei Bekannten, aber ich richte mich nicht häuslich ein. Ich kehre ein und ziehe wieder aus, und zwar bereichert. So geht mir’s im Moment mit Spengler, diesem Magier der Sprache. Ich war ‒ als die 68-er vor ihm warnten wie der Christ vorm Gott-sei-bei-Uns ‒ hingerissen von ihm und nun gibt es einmal mehr ein Wiedersehen; man nimmt sich in den Arm, herzt und küsst sich, es ist wundervoll, dann nimmt man dankbar Abschied. Aber eines bleibt: Die Gewißheit, dass die Philosophie unendlich reich ist an Gestalten, eine Fülle von Welten, bunt, vielfältig und voller Widersprüche, die zu denken geben, also stacheln und so das Weiterdenken animieren. Bei alledem ist eines sicher: Es kommt keine Langeweile auf.PV:
Nun schreiben Sie ja auch und Sie lehren. Gibt es eine zentrale Botschaft, die Sie mitteilen wollen?
GA:
Ich versuche für eine Haltung zu werben, die es Menschen erlaubt, mit offenen, interessierten Augen durch die Welt zu gehen ‒ was ihnen in der Regel nur und überhaupt erst dann gelingt, wenn sie sich nicht mehr ängstlich vor irgendeiner unerschütterlichen Wahrheit ducken. Den Eingeschüchterten muss man auf die Beine helfen, dass sie das Aufrechtstehen lernen, den Bescheidwissern aber und den Selbstgerechten das Leben schwer machen. Doch da höre ich schon den Kommentar der Schlauberger, die auf alles ihre Etiketten kleben: „Das ist ja die reine Postmoderne!” Gut, einverstanden, das mag „post-modern” anmuten. Aber was scheren mich solche Titel? In der Neuzeit, in der Moderne ist der Vorrat lebensanweisender, jedermann bindender Gewissheiten und Geltungen geschrumpft. Was statt dessen flutet und die Menschen tacktet, damit sie bei Fuße gehen, sind Gesinnungen und Moden, von Zeit zu Zeit eine gemeinsame Erregung, ein kollektiver Alarm, aber dann hat man bald wieder etwas anderes und Neues und so geht’s dahin. Nietzsche nannte diese Verfassung den Nihilismus, andere hatten andere Worte dafür. Aber ist das ein Grund zur Verzweiflung? Nein. Im Grunde bekommt es dem Menschen, wenn er, aus jahrhundertelanger geistiger Obhut entlassen, einmal auf sich selbst gestellt ist. Was er dann aber nötig hat, ist kein neuer Vormund, auch keiner, der in seiner Seele kramt, sondern der Philosoph, der mit ihm Wege auskundschaftet, bisher Unbedachtes und Unentdecktes zu Tage fördert und Mut macht, seinem innersten Organ zu folgen, womit nicht der Bauch gemeint ist, der ‒ komisch genug ‒ gegenwärtig Konjunktur hat, sondern das „denkende Herz”. Ein Wort Hegels übrigens, das richtig daran erinnert: Wie es gedankenlose Herzen gibt, gibt es herzlose Gedanken, und eines ist so schlimm wie das andere. Hinzu kommt: Schaden richten sie beide an.
PV:
Sie bilden auch philosophische Praktiker aus. Braucht es noch welche?
GA:
In dem Maße, in dem intelligente Maschinen unsere Arbeit übernehmen, in dem Maße werden wir immer mehr Menschen nötig haben, die es verstehen, Mensch und keine Maschine zu sein.”
Da müssen Sie mir zuerst erlauben, an ihrer Frage ein wenig zu rütteln. Denn was ich anbiete ist keine Berufsausbildung ‒ es ist ein Lehrgang, eine Weiterbildung, im besten, strengsten und anspruchsvollsten Sinn Bildung überhaupt. Das Resultat von Bildung aber ist nicht, dass jemand dann etwas „hat” oder „weiß” oder „beherrscht”, sondern dass er jemand wurde, jemand ist am Ende, einer, dem man vertrauen, auf den man bauen, von dem man lernen kann, einer, der als Mensch überzeugt. Da geht es also nicht darum, Menschen geistiges Handwerks- oder sonstiges Rüstzeug in die Hand zu geben, mit denen sie dann andere beglücken ‒ „behandeln”, „belehren”, „heilen”, „therapieren” ‒, sondern was sie gewinnen, gewinnen für sich selbst, und bevor sie dazu kommen, machen sie etwas durch.
Ich sollte dies ergänzen: Die Frage „wozu Philosophie?” ist seit der Antike, wo sich damals in Griechenland das philosophische Denken auf den Weg gemacht hat, immer so beantwortet worden: Philosophie treibe ich nicht um Spezialist, Fachmann, Experte zu werden ‒ etwa für sogenannte „philosophische Fragen” ‒, sondern um am Ende als Mensch ernstgenommen werden zu können. Es geht darum, sich den Vorzug, Mensch zu sein, zu verdienen. Das ist ein höchst anspruchsvolles Programm, wie die Griechen wussten, weil sie verstanden, das Leben gelingt nicht einfach so, indem man es herunterlebt, sondern es bedarf der Führung, der Lebensführung, es ist, wie ich dies nenne, eine Frage der Lebenskönnerschaft. Und die bedarf der klugen Einsicht, weiser Übersicht und alles dessen, was man einst „Tugenden” nannte: da ist Besonnenheit nötig, Mut erforderlich, ein unwankender Gerechtigkeitssinn, zuletzt, um das steife Wort „Gutsein” zu vermeiden: Güte.
Sofern dies klar ist, darf Ihre Zusatzfrage mit einem nachsichtigen Lächeln quittiert werden ... War Ihre Nachfrage nicht, ob man von solchen Menschen „noch welche brauche”? Da möchte ich mit aller Bescheidenheit umgekehrt fragen, ob wir von solchen Menschen wohl jemals genug haben könnten? Die Antwort kann nur lauten: nein.
Aber selbstverständlich weiß ich, Sie wollten mit Ihrer Frage auf etwas anderes hinaus. Sie fragen sich, ob ein so „gebildeter” Mensch in der Welt der Berufe und der Arbeit gebraucht wird? Da begibt sich also jemand drei Jahre lang in einen intensiven, anspruchsvollen, oft wohl sogar überfordernden Lehrgang, er macht was durch, wird in Grenzen unterdessen ein anderer, im Bild gesprochen: er setzt geistig Fleisch an ‒ und dann? Nun, es sind in der Regel wenige, die im strengen oder, sagen wir mal, im expliziten Sinne als philosophische Praktiker zu reüssieren versuchen. Vielmehr machen die Teilnehmer, nachdem sie den Lehrgang absolviert haben, auf sehr bunte und höchst unterschiedliche Weise etwas damit. Sie haben sich Fähigkeiten erworben, die nach und nach immer wichtiger werden in einer Welt, in der gewissermaßen alle „technisch” erwerbbaren Qualifikationen an Algorithmen übergehen und mehr und mehr von Computern übernommen werden. Insofern geht es dem, der sich in der Vielfalt und im Reichtum des philosophischen Denkens umgetan und davon für sich profitiert hat, ähnlich wie dem Juristen, der auf seine bestimmte Art gelernt hat, Sachverhalte nüchtern, sachlich, vorurteilsfrei und analytisch gründlich anzuschauen, der es vor allem nicht nötig hat, wie „alle Welt” zu ticken. Dabei ist die so juristisch erworbene Disziplin des Denkens und Urteilens, so sehr wir sie brauchen in einer zunehmend verhetzten Welt, noch immer eingeschränkt und eine Spezialität im Vergleich zu dem, was ich mir für mich philosophisch erwerbe. Und die These, die ich mir einmal als Prophezeiung erlaube, lautet: In dem Maße, in dem intelligente Maschinen unsere Arbeit übernehmen, in dem Maße werden wir immer mehr Menschen nötig haben, die es verstehen, Mensch und keine Maschine zu sein. Die vor allem begriffen haben, wie hoch gegriffen der Anspruch ist, in wirklich überzeugender Weise Mensch zu sein und nicht ein „Irgendwer”. Ich kann dasselbe auch anders sagen: Was unsere Welt in erster Linie nötig hat, ist nicht Intelligenz, sondern Weisheit.PV:
Würden Sie Frau Merkel anraten anders zu denken, als sie bisher gedacht hat?
GA:
Das Feld, auf dem politische Urteile vorgetragen werden, ist inzwischen vermintes Gelände. Und die Frage nach dem Denken der Frau Bundeskanzlerin ist die nach ihrer politischen Urteilsfähigkeit und ihrem politischen Verhandlungs- und Entscheidungsgeschick. Eine schwierige Einschätzungsfrage. Lange Zeit, so mein Eindruck, hat sie mit erstaunlicher Flexibilität und praktizierter Grundsatzungebundenheit jeweils „spontan” und jedenfalls rasch auf neue Anforderungslagen reagiert. Das hat ihr ein langes politisches Überleben ermöglicht und weltweite Anerkennung erworden. Inzwischen jedoch, so mein Verdacht, wird vor dem Hintergrund ausgetauschter Erwartungen dieses Vermögen als „Manövrieren” und „Durchwurschteln” beargwöhnt, und so sind ihre Tage gezählt. Doch die Frau Bundeskanzlerin braucht keinen Rat vom Philosophen, sondern wenn ihre Zeit um ist, sind eben andere dran. Und noch weiß keiner, ob wir dann jener anderen froh sein werden.

PV:
Was empfehlen Sie jungen Menschen, die sagen, dass sie Philosophie studieren wollen?
GA:
Denen empfehle ich erstmal gar nichts, sondern denen mute ich gern ein Zitat zu. Es ist die Antwort, die mein hoch verehrter, jetzt verstorbenen Lehrer Odo Marquard einst einer besorgten Mutter gab, die ihn fragte, was er davon halte, dass ihr tüchtiger Sohn Philosophie studieren wolle. Odo Marquard gab ihr zur Antwort, das Studium der Philosophie sei in der Regel nicht der Beginn einer Karriere, sondern der Anfang einer Tragödie ‒ die freilich manchmal, wenn auch sehr selten, gut ausgehe.
PV:
Etwa, wenn er eine Philosophische Praxis aufmacht?
GA:
Dazu müsste er freilich eine ganze Reihe von Sondertalenten mitbringen. Außerdem würde ich ihm sogleich raten, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern beispielsweise, wie ich es ja nicht anders mache, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben, sich mit Artikeln in die öffentlichen Debatten einzumischen. Erfolg verlangt, heute mehr denn je, Bekanntheit. Und die erwirbt sich niemand, während er in der Ecke sitzt.
PV:
Ist Herr Precht ein gutes Beispiel für die neue Generation der Philosophen, weil er jemand ist, der wahrgenommen wird?
GA:
Also, was Richard David Precht angeht, so gehört er zu jenen Menschen, die ich erst nach und nach schätzen lernte. Das Buch, das ihn gewissermaßen über Nacht bekannt gemacht hat, dieses reißerische „Wer bin ich ‒ und wenn ja, wie viele?”, war ich nicht in der Lage zu Ende zu lesen. Gerechter Weise ist dazu allerdings zu sagen, er selbst hat mehrfach eingeräumt, ihm sei dieses Buch inzwischen ein wenig peinlich, was nur dadurch gemildert werde, dass er es ja eigentlich für Kinder oder Jugendliche geschrieben habe. Doch dann, später, habe ich ihn zu den verschiedensten Themen sprechen gehört und Stellungnahmen, Einschätzungen von ihm gelesen, und dies mit Respekt und Achtung. In aller Regel ist er als Teilnehmer öffentlicher Gesprächsrunden exzellent vorbereitet, seine Urteile belegen eine umfängliche, alteuropäisch-altklassische Bildung, und allemal ist er kein Fachidiot, sondern einer, der sich mit wachen, aufmerksamen Sinnen in der Welt umgetan hat. Das ist selten heute und verdient Anerkennung. Im übrigen habe ich den Eindruck, das er aus Überzeugung selbst schroffe oder nachdrückliche Urteile zu revidieren bereit ist, wenn er gute Gründe oder Anlässe sähe, sie zu modifizieren. Ergo: Precht ist ein gutes Beispiel für einen weltzugewandten und nicht aus der Welt sich zurückziehenden Denker, einer, der es verschmäht, sich im philosophischen Séparée zu verkriechen.
PV:
Was macht Ihnen die größte Freude?
GA:
Solche Interviews.
PV:
Was für ein schöner Schlusssatz. Danke für das Gespräch Dr. Achenbach.
http://www.achenbach-pp.de/







